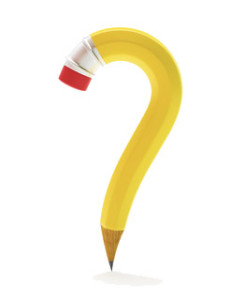Inklusion und Schule – gleichberechtigte Partnerschaft von Pädagogik und Sozialer Arbeit?
Fast jeder dritte Schüler mit Behinderung oder sozialer Beeinträchtigung besucht mittlerweile eine Regelschule – Inklusion ist in den Schulen angekommen, allerdings bisher deutlich mehr in Grundschulen als in Realschulen und Gymnasien.
Schulen aller Schulformen stehen derzeitig vor der Herausforderung und dem politischen Druck, sich im Rahmen des Inklusionsprozesses neu zu orientieren und (visionär) weiterzuentwickeln. Während klar scheint, dass inklusive Schulen Zugangsbarrieren, soziale Benachteiligungen und Diskriminierung abbauen sowie Partizipation und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen, wurde die Rolle der Sozialen Arbeit (Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit) in der alltagspraktischen Umsetzung bislang nur am Rand beleuchtet.
Der Inklusionsbegriff wird ohnehin häufig zu eng gefasst und oft nur auf Menschen mit Behinderungen bezogen. Inklusion steht aber auch für die gesellschaftliche Bereicherung durch Heterogenität (Unterschiedlichkeit) und Vielfalt. Damit entstehen mit der Einführung integrativer Konzepte in den Schulbereich auch Schnittpunkte zwischen der Heil- und Sonderpädagogik sowie der Jugendsozialarbeit.
Übrigens: Inklusion ist nicht gleich Integration. Menschen mit Behinderung(en) müssen sich nicht verändern und in bereits bestehende Gefüge integriert werden. Vielmehr ist die Schaffung von Strukturen notwendig, dass nicht nur Menschen mit Behinderung(en), sondern alle Mitglieder der Gesellschaft ihr Recht auf Chancengleichheit, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe auch wirklich einlösen können.
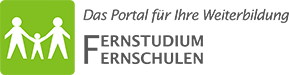
 Mit dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz für Kinder mit vollendetem ersten Lebensjahr ab 1. August 2013 gelten Kindertagesstätten als Wachstumsbranche schlechthin. Während im Jahr 2006 Bund, Länder und Kommunen etwa zehn Milliarden Euro in die Kinderbetreuung investierten, explodieren seither die Ausgaben. So schlug das Jahr 2014 immerhin mit fast 23 Milliarden Euro zu Buche.
Mit dem gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz für Kinder mit vollendetem ersten Lebensjahr ab 1. August 2013 gelten Kindertagesstätten als Wachstumsbranche schlechthin. Während im Jahr 2006 Bund, Länder und Kommunen etwa zehn Milliarden Euro in die Kinderbetreuung investierten, explodieren seither die Ausgaben. So schlug das Jahr 2014 immerhin mit fast 23 Milliarden Euro zu Buche. Soziales Verhalten umfasst alle unsere (positiven und negativen) Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen und gehört damit zu den Alltäglichkeiten unseres Lebens: Wir mögen, lieben oder hassen andere Personen, unterstützen Freunde, Kollegen oder Studierende, ärgern uns über andere und schimpfen vor uns hin, arbeiten in Teams an gemeinsamen Zielen oder konkurrieren um das beste Ergebnis, begegnen Fremden zuvorkommend, zurückhaltend und freundlich, akzeptieren andere Meinungen und Sichtweisen, achten ältere und lebenserfahrene Menschen.
Soziales Verhalten umfasst alle unsere (positiven und negativen) Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen und gehört damit zu den Alltäglichkeiten unseres Lebens: Wir mögen, lieben oder hassen andere Personen, unterstützen Freunde, Kollegen oder Studierende, ärgern uns über andere und schimpfen vor uns hin, arbeiten in Teams an gemeinsamen Zielen oder konkurrieren um das beste Ergebnis, begegnen Fremden zuvorkommend, zurückhaltend und freundlich, akzeptieren andere Meinungen und Sichtweisen, achten ältere und lebenserfahrene Menschen. Der Mann als harter Kerl passt nicht so recht ins Erzieher-Klischee. Warum? Weil der Erzieherberuf immer noch eine Frauendomäne ist, Männer die Welt regieren und von
Der Mann als harter Kerl passt nicht so recht ins Erzieher-Klischee. Warum? Weil der Erzieherberuf immer noch eine Frauendomäne ist, Männer die Welt regieren und von  Im Verlauf und Auswertung des Förderprogramms „MEHR Männer in die Kitas“ wurde mehr und mehr deutlich, dass sich nicht vorrangig die förderberechtigen Arbeitsuchenden für diese Art der Neuqualifizierung begeisterten, sondern eher lebens- und berufserfahrene Menschen im mittleren Alter mit dem Ziel einer beruflichen Neu- oder Umorientierung. Zudem bieten lang dauernde und nicht vergütete Neuqualifizierungen, die zudem (meist) ohne staatliche
Im Verlauf und Auswertung des Förderprogramms „MEHR Männer in die Kitas“ wurde mehr und mehr deutlich, dass sich nicht vorrangig die förderberechtigen Arbeitsuchenden für diese Art der Neuqualifizierung begeisterten, sondern eher lebens- und berufserfahrene Menschen im mittleren Alter mit dem Ziel einer beruflichen Neu- oder Umorientierung. Zudem bieten lang dauernde und nicht vergütete Neuqualifizierungen, die zudem (meist) ohne staatliche  Bereits seit 2004 stricken Deutschlands Hochschulen an Konzepten für
Bereits seit 2004 stricken Deutschlands Hochschulen an Konzepten für