Soziale Arbeit – Musik und Bewegung
Die Förderung von Sport und Spiel ist in kommunalen Haushalten eher schmückendes Beiwerk, wohingegen in allen gesellschaftlichen Bereichen, Soziale Arbeit eingeschlossen, die Bedeutung von Sport und Spiel als unverzichtbarer Bestandteil ganzheitlicher Bildungsförderung allgegenwärtig ist. Bewegung sorgt nicht nur für einen gesunden Körper und Geist, sondern beeinflusst auch kognitive Fähigkeiten, Lernprozesse und stärkt nicht zuletzt soziale Kompetenzen (z. B. Teamfähigkeit), fördert den fairen Umgang und die Integration. Heißt: Gesundheit, Körper, Bewegung und Ernährung sind untrennbar miteinander verbunden.
Bewegungskünstler gegen Smartphone-Junkies
Kinder verfügen (glücklicherweise) über einen natürlichen Bewegungsdrang. Umso schwerer fällt es zu glauben, dass sich heute Kinder und Jugendliche nicht mehr für Bewegung und Sport begeistern (lassen). Dabei ist es doch eher so, dass u. a. der veränderte Lebenswandel vieler Erwachsener auch beim Nachwuchs mehr oder weniger deutliche Spuren hinterlässt. Welches Kind ist scharf darauf, allein auf dem Spielplatz zu toben, währenddessen Eltern oder Geschwister auf ihr Handy starren. Und wer sammelt schon gerne alleine Kastanien im Wald, schnitzt Stöckchen und balanciert auf umgefallenen Baumstämmen, wenn sich Freizeit auch von der Couch aus organisieren und digital verbringen lässt?
Nicht umsonst werden heute Übergewicht, Diabetes, ungesunde Körperhaltung, fehlende Belastbarkeit oder „Bewegungsclowns“ beklagt, sondern auch verschiedenste koordinative und konditionelle Fähigkeiten vermisst. Ursache und Wirkung!
Natürlich verläuft der Alltag heute anders als vor 30 Jahren. Durch Ganztagesbeschulung, Schulbus, berufstätige Eltern im Spagat zwischen Arbeits- und Privatleben sowie schlechtem Gewissen, häufig nicht in der Nähe wohnende Großeltern sowie fehlende soziale Kontakte zu Nachbarn oder Schulkameraden ist ein strukturierter Tagesablauf oft schon eine Herausforderung.
Bewegung als Schlüssel zur Welt
Eine gezielte Bewegungsförderung im Kindesalter gehört zu den Kernaufgaben frühkindlicher Bildung und Erziehung. Bereits in dieser Lebensphase setzen wichtige kognitive, motorische, sozial-emotionale und sprachliche Entwicklungsprozesse ein, die die kindliche Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich beeinflussen. Bewegung ist dabei nicht als Sport mit Leistungscharakter zu verstehen, sondern als Lerngegenstand, Medium zur Gesundheitserziehung und des Lernens sowie Grundvoraussetzung für schulisches Lernen.
Die frühkindliche Entwicklung ist durch eine aktive sinnliche Aneignung der Welt geprägt. Die Entwicklung und Differenzierung der grob- und feinmotorischen Fähigkeiten wie Greifen, Laufen, Klettern, Springen und Werfen sowie der Koordination von Körperbewegungen (z. B. Gleichgewicht, Reaktion, Augen-Hand-Koordination) gestattet immer differenziertere Wahrnehmungserfahrungen als Grundlage des Denkens. Mit vielfältigen Bewegungsangeboten, einem inspirierenden sozialen Umfeld sowie genügend Gelegenheiten für die Bewegungsausübung können u.a. kognitive Strukturen gefördert, Selbstständigkeit, Sicherheit, Handlungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit und produktive Problemlösungsstrategien begünstigt und nicht zuletzt elementare Voraussetzungen für lebenslanges Sporttreiben geschaffen werden.
Bewegungsaktivitäten als Medium zur Gesundheitserziehung richtet sich auf die Förderung physischer und psychischer Gesundheitsressourcen. Körperliche Fitness, kräftige Muskulatur und gesunde Körperhaltung bewirken durch realistischere Situationseinschätzungen die Entwicklung von Risikokompetenzen sowie die Minimierung von Verletzungsgefahren durch eine verbesserte Körperkontrolle. Zudem verbessert eine geschulte Wahrnehmung und Konzentration auf den eigenen Körper den Stressabbau.
Bewegung als Lernmedium betrachtet den Zusammenhang von motorischen Bewegungsaktivitäten sowie Lern- und Denkprozessen ein. Mit Bewegung, Sport und Spiel begreifen Kinder ihre Umwelt und ihren Körper mit all seinen Sinnen, erwerben entscheidende Kompetenzen und Wissen in sämtlichen Bildungsbereichen (z. B. Kulturtechniken, Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften), sammeln erste Erfahrungen mit Balance, Reibung oder Fliehkraft und entwickeln ein Verständnis für die reale Welt.
Nicht zuletzt führt Bewegung führt zu einer höheren Effizienz schulischen Lernens, da die Sauerstoffaufnahme und Durchblutung des Gehirns verbessert, die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit und somit Gedächtnisleistungen und Lernprozesse gesteigert sowie ein höheres Motivationslevel gesichert werden kann.
Jugend, Sport und Abenteuerpädagogik
Bewegungsangebote spielen nicht nur in der Frühpädagogik, sondern auch bei Schulkindern und Jugendlichen eine zentrale Rolle. Allerdings geht es in diesen Altersbereichen nicht nur um den Erwerb von Entwicklungsgrundlagen, sondern zugleich um soziale Kompetenzen, Prävention, gesunde Ernährung, die Präsentation des eigenen Körpers sowie den sportlichen Vergleich mit Fun- oder Wettkampfcharakter.
Darüber hinaus eignet sich der Sport in all seinen Facetten auch in der Sozialarbeit, um unverbindlich Kontakte zu vermeintlichen Randgruppen zu knüpfen, sie für eine Beteiligung an sozialräumlicher Arbeit zu motivieren, Konflikte gewaltfrei zu lösen und im besten Fall Veränderungsbereitschaft zu erzeugen und Verantwortung zu übertragen. Zudem können bei Jugendgruppen und Schulklassen u. a. mit freizeit- und abenteuerpädagogischen Angeboten nachhaltige Effekte erzielt werden, die zu einem besseren Teamflow beitragen.
Sportliche Fachkräfte im Sozialwesen?
Jugendbetreuer, Erzieher, Sozialarbeiter oder Freizeitpädagogen müssen nicht zwangsläufig Sportskanonen sein, auch in Stellenausschreibungen wird dies nicht explizit vorausgesetzt werden. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, wenn Kindern und Jugendlichen nicht nur ein bewegter Alltag „gepredigt“, sondern auch vorgedacht und -gelebt wird.
Auch eine Reihe von Kindertagesstätten haben in den letzten Jahren Konzepte mit sportlichem Profil entwickelt (z. B. Bewegungs-, Sport- oder Waldkindergärten). Zudem finden sich in der breiten Trägerlandschaft dafür auch prädestinierte Anbieter wie etwa die Sportjugend.
Neben täglichen Bewegungsangeboten im Innen- und Außenbereich sowie kreativen (preiswerten) Spielen mit Alltagsmaterialien wie Klammern, Korken, Tüchern oder Luftballons tragen auch regelmäßige Sportstunden im eigenen Turnraum bzw. der Turnhalle, Projekttage sowie Schwimmbadbesuche dazu bei, Spaß an Bewegung zu wecken und langfristig zu fördern. Zudem verhilft eine bewegte Kindheit auch dazu, etwa die Schwimmfähigkeit und mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erlangen. Wer bereits frühzeitig sicher Fahrrad fahren kann und den Weg zur Kita bzw. Schule eben nicht mit dem „Elterntaxi“ zurücklegt, kann Gefahrensituationen meist besser erkennen und bewältigen.
Konsequenzen und Empfehlungen für mehr Bewegung
Frühzeitige Bewegungsaktivitäten sind für die Förderung grundlegender motorischer, sozialer, kognitiver und emotionaler Kompetenzen ebenso notwendig wie die Schaffung von Ressourcen für Lern- und Bildungsprozesse sowie die Unterstützung einer gesunden Entwicklung. Daher ist „Bewegung“ in den Bildungsplänen der Bundesländer verbindlich zu verankern und flexibel in den Kindergarten- und Schulalltag einzubinden. Nur so können vielfältige Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen gesammelt, Kreativität und Phantasie angeregt, Gesundheitsressourcen entwickelt sowie koordinative und konditionelle Fähigkeiten ausgebildet werden.
Die Aus- und Weiterbildung von sozialpädagogischen Fach- und Lehrkräften sowie Multiplikatoren ist so zu evaluieren, dass das Erleben neuer Bewegungserfahrungen als Kernaufgabe wahrgenommen, in die Praxis implementiert und professionell umgesetzt wird. Darüber hinaus tragen verlässliche Partnerschaften mit Sportvereinen dazu bei, sowohl die frühkindliche Bewegungsbildung als auch Sportinitiativen von Jugendlichen flankierend zu unterstützen. Die (sportliche) Bildung ist dabei auch in Schulen, Familien, Kommunen und Gesellschaft zu verankern, so dass ein bewegter Alltag (auch im Team), ausgewogene Ernährung und ein insgesamt gesunder Lebensstil zum Anspruch und Leitbild gehört.
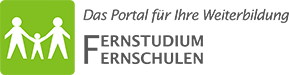
 Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verursacht nicht nur in der Sozialen Arbeit Unsicherheit, auch wenn die Datenschutzanforderungen schon länger gelten und
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verursacht nicht nur in der Sozialen Arbeit Unsicherheit, auch wenn die Datenschutzanforderungen schon länger gelten und  Beratungsstellen (z. B. Schwangeren-, Sucht- oder Erziehungsberatung) sowie staatlich anerkannte Sozialarbeiter und -pädagogen, unter Strafandrohung, fremde, ihnen anvertraute Geheimnisse nicht unbefugt zu offenbaren. Damit wird dem Datenschutz-Grundrecht von Klienten auf die informationelle Selbstbestimmung entsprochen, nach dem jeder selbst entscheiden kann, wem er was wofür preisgibt.
Beratungsstellen (z. B. Schwangeren-, Sucht- oder Erziehungsberatung) sowie staatlich anerkannte Sozialarbeiter und -pädagogen, unter Strafandrohung, fremde, ihnen anvertraute Geheimnisse nicht unbefugt zu offenbaren. Damit wird dem Datenschutz-Grundrecht von Klienten auf die informationelle Selbstbestimmung entsprochen, nach dem jeder selbst entscheiden kann, wem er was wofür preisgibt. nervig, aber alternativlos. Wenn alle Zielgruppen Sozialer Arbeit, egal ob Kind, Jugendlicher, Kranker, Alter, Drogensüchtiger oder Extremist ans „schwarze Brett“ genagelt werden, bleiben alle sozialen Interaktionen und Hilfeprozesse wirkungslos. Das kann keiner wollen, auch wenn es im Einzelfall in den Fingern juckt.
nervig, aber alternativlos. Wenn alle Zielgruppen Sozialer Arbeit, egal ob Kind, Jugendlicher, Kranker, Alter, Drogensüchtiger oder Extremist ans „schwarze Brett“ genagelt werden, bleiben alle sozialen Interaktionen und Hilfeprozesse wirkungslos. Das kann keiner wollen, auch wenn es im Einzelfall in den Fingern juckt.  Bundesfreiwilligendienst – stehen hoch im Kurs. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) bietet jungen Frauen und Männern bis zu 27 Jahren Chancen zur beruflichen Orientierung und ermöglicht zugleich, Anderen etwas Gutes zu tun. Bei praktischen Arbeiten in gemeinnützigen Einrichtungen, im Natur- und Umweltschutz oder bei Hilfsprojekten im Ausland können junge Leute nicht nur Schlüsselqualifikationen erlangen, an Selbstständigkeit gewinnen, Selbstbewusstsein tanken und einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen, sondern auch ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit verbessern und für die Übernahme gemeinnütziger ehrenamtlicher Funktionen motiviert werden. Bei Jugendfreiwilligendiensten spielen Schulabschlüsse, soziale Herkunft oder Einkommenssituation keine Rolle.
Bundesfreiwilligendienst – stehen hoch im Kurs. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder der Internationale Jugendfreiwilligendienst (IJFD) bietet jungen Frauen und Männern bis zu 27 Jahren Chancen zur beruflichen Orientierung und ermöglicht zugleich, Anderen etwas Gutes zu tun. Bei praktischen Arbeiten in gemeinnützigen Einrichtungen, im Natur- und Umweltschutz oder bei Hilfsprojekten im Ausland können junge Leute nicht nur Schlüsselqualifikationen erlangen, an Selbstständigkeit gewinnen, Selbstbewusstsein tanken und einen Einblick in die Arbeitswelt bekommen, sondern auch ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit verbessern und für die Übernahme gemeinnütziger ehrenamtlicher Funktionen motiviert werden. Bei Jugendfreiwilligendiensten spielen Schulabschlüsse, soziale Herkunft oder Einkommenssituation keine Rolle.

 verstaubten Namen verbirgt, ist aktueller denn je.
verstaubten Namen verbirgt, ist aktueller denn je.
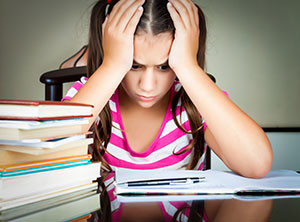 Im Jahr 2015 wurde von Prof. Dr. Holger Ziegler von der Universität Bielefeld eine Stress-Studie zum Thema „Burn-Out im Kinderzimmer: Wie gestresst sind Kinder und Jugendliche in Deutschland?“ veröffentlicht.
Im Jahr 2015 wurde von Prof. Dr. Holger Ziegler von der Universität Bielefeld eine Stress-Studie zum Thema „Burn-Out im Kinderzimmer: Wie gestresst sind Kinder und Jugendliche in Deutschland?“ veröffentlicht.
 Medienpädagogik bzw. Medienkompetenz ist ein Teilbereich der Sozialen Arbeit. Einerseits nutzen Sozialarbeiter die digitalen Medien für ihre Dokumentationen, die Fortschreibung von Hilfe- und Jugendförderplänen, die Erstellung von Flyern, Plakaten und Protokollen, das
Medienpädagogik bzw. Medienkompetenz ist ein Teilbereich der Sozialen Arbeit. Einerseits nutzen Sozialarbeiter die digitalen Medien für ihre Dokumentationen, die Fortschreibung von Hilfe- und Jugendförderplänen, die Erstellung von Flyern, Plakaten und Protokollen, das 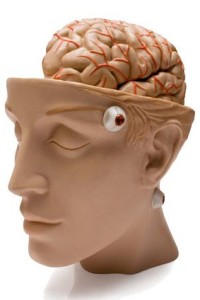 Ein bisschen Psychologie ist überall dabei, etwa auch im breiten Einsatzspektrum der Sozialen Arbeit? Auf jeden Fall!
Ein bisschen Psychologie ist überall dabei, etwa auch im breiten Einsatzspektrum der Sozialen Arbeit? Auf jeden Fall! Pünktlich zum Jahresende versetzen uns die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage nicht nur in Stress und Hektik, sondern wir werden vom Kommerz erschlagen und geraten in allerlei persönliche Zwickmühlen. Soziale Themen, sonst meist nur eine Randnotiz wert, erhalten plötzlich völlig andere Dimensionen in der Berichterstattung und in der öffentlichen Wahrnehmung. Alles Berechnung, oder?
Pünktlich zum Jahresende versetzen uns die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage nicht nur in Stress und Hektik, sondern wir werden vom Kommerz erschlagen und geraten in allerlei persönliche Zwickmühlen. Soziale Themen, sonst meist nur eine Randnotiz wert, erhalten plötzlich völlig andere Dimensionen in der Berichterstattung und in der öffentlichen Wahrnehmung. Alles Berechnung, oder?  Mit Mediation konnten wir bis vor einigen Jahren noch nicht viel anfangen, denn wir haben „Kraft unserer Wassersuppe“ ein eigenes
Mit Mediation konnten wir bis vor einigen Jahren noch nicht viel anfangen, denn wir haben „Kraft unserer Wassersuppe“ ein eigenes 
 Freizeiten werden hauptsächlich während der Ferien angeboten, um Kinder, Jugendlichen oder Familien möglichst unbekümmerte gemeinsame Tage in der Gemeinschaft und außerhalb des eigenen Wohnorts zu ermöglichen. Für die Organisation und Durchführung derartiger Maßnahmen sind freie Träger oder Jugendämter besonders prädestiniert, weil sie im Vergleich zu kommerziellen Anbietern in der Regel auch über ein hohes Maß an sozialpädagogischem Know how verfügen.
Freizeiten werden hauptsächlich während der Ferien angeboten, um Kinder, Jugendlichen oder Familien möglichst unbekümmerte gemeinsame Tage in der Gemeinschaft und außerhalb des eigenen Wohnorts zu ermöglichen. Für die Organisation und Durchführung derartiger Maßnahmen sind freie Träger oder Jugendämter besonders prädestiniert, weil sie im Vergleich zu kommerziellen Anbietern in der Regel auch über ein hohes Maß an sozialpädagogischem Know how verfügen. Seit Monaten bestimmt die Flüchtlingskrise die öffentliche Diskussion nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland von Berlin bis hin in den kleinste Gemeinde. Eigentlich hören wir schon gar nicht mehr zu, was uns die
Seit Monaten bestimmt die Flüchtlingskrise die öffentliche Diskussion nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland von Berlin bis hin in den kleinste Gemeinde. Eigentlich hören wir schon gar nicht mehr zu, was uns die  Wird der Bereich der
Wird der Bereich der  Wenn Besucher, Eltern, Neugierige oder stille Beobachter über das Angebot, die Einrichtung oder die tätigen
Wenn Besucher, Eltern, Neugierige oder stille Beobachter über das Angebot, die Einrichtung oder die tätigen 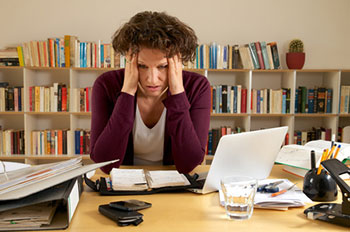 Egal ob in der
Egal ob in der 
 Aus Sicht von Sozialassistenten und Heilerziehungspflegern reduzieren wir die
Aus Sicht von Sozialassistenten und Heilerziehungspflegern reduzieren wir die  Soziales Verhalten umfasst alle unsere (positiven und negativen) Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen und gehört damit zu den Alltäglichkeiten unseres Lebens: Wir mögen, lieben oder hassen andere Personen, unterstützen Freunde, Kollegen oder Studierende, ärgern uns über andere und schimpfen vor uns hin, arbeiten in Teams an gemeinsamen Zielen oder konkurrieren um das beste Ergebnis, begegnen Fremden zuvorkommend, zurückhaltend und freundlich, akzeptieren andere Meinungen und Sichtweisen, achten ältere und lebenserfahrene Menschen.
Soziales Verhalten umfasst alle unsere (positiven und negativen) Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen und gehört damit zu den Alltäglichkeiten unseres Lebens: Wir mögen, lieben oder hassen andere Personen, unterstützen Freunde, Kollegen oder Studierende, ärgern uns über andere und schimpfen vor uns hin, arbeiten in Teams an gemeinsamen Zielen oder konkurrieren um das beste Ergebnis, begegnen Fremden zuvorkommend, zurückhaltend und freundlich, akzeptieren andere Meinungen und Sichtweisen, achten ältere und lebenserfahrene Menschen.
 In den vergangenen Monaten war der
In den vergangenen Monaten war der  Neulich fragten mich meine Eltern, ob ich wegen ihrer Rentenerhöhung sauer auf sie wäre. Zuerst verstand ich die Frage nicht. Als sie mir erzählten, dass junge Menschen heute Solidarprinzip und Generationenvertrag in Frage stellen, wurde mir der Hintergrund der Frage klar. Bisher hatte ich noch nicht ernsthaft über Generationengerechtigkeit nachgedacht. Doch lebt die ältere Generation wirklich auf Kosten der Jungen und verprasst damit unser Tafelsilber?
Neulich fragten mich meine Eltern, ob ich wegen ihrer Rentenerhöhung sauer auf sie wäre. Zuerst verstand ich die Frage nicht. Als sie mir erzählten, dass junge Menschen heute Solidarprinzip und Generationenvertrag in Frage stellen, wurde mir der Hintergrund der Frage klar. Bisher hatte ich noch nicht ernsthaft über Generationengerechtigkeit nachgedacht. Doch lebt die ältere Generation wirklich auf Kosten der Jungen und verprasst damit unser Tafelsilber?

 In vielen kommunalen Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen Deutschlands wird seit Anfang Mai unbefristet gestreikt. Für die Eltern herrscht seither Alarmstufe Rot, weil sie für die Suche nach Betreuungsalternativen für ihre Kinder selbst verantwortlich sind.
In vielen kommunalen Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen Deutschlands wird seit Anfang Mai unbefristet gestreikt. Für die Eltern herrscht seither Alarmstufe Rot, weil sie für die Suche nach Betreuungsalternativen für ihre Kinder selbst verantwortlich sind. Ob Mädchen oder Junge – die Geschlechterfrage ist eng damit verbunden, in welche Schublade Kinder geschoben werden und wie wir ihnen begegnen.
Ob Mädchen oder Junge – die Geschlechterfrage ist eng damit verbunden, in welche Schublade Kinder geschoben werden und wie wir ihnen begegnen. Häusliche Gewalt zählt heute noch zu den gesellschaftlichen Tabuthemen, denn was hinter den Wohnungstüren und in den eigenen 4 Wänden passiert, geht schließlich niemanden etwas an. Aber ist häusliche Gewalt wirklich Privatsache?
Häusliche Gewalt zählt heute noch zu den gesellschaftlichen Tabuthemen, denn was hinter den Wohnungstüren und in den eigenen 4 Wänden passiert, geht schließlich niemanden etwas an. Aber ist häusliche Gewalt wirklich Privatsache? Fast täglich erreichen uns Meldungen zu weiteren Flüchtlingszahlen, wir erleben emotionale Diskussionen zu Standorten von Gemeinschaftsunterkünften, hören von
Fast täglich erreichen uns Meldungen zu weiteren Flüchtlingszahlen, wir erleben emotionale Diskussionen zu Standorten von Gemeinschaftsunterkünften, hören von  Der Mann als harter Kerl passt nicht so recht ins Erzieher-Klischee. Warum? Weil der Erzieherberuf immer noch eine Frauendomäne ist, Männer die Welt regieren und von
Der Mann als harter Kerl passt nicht so recht ins Erzieher-Klischee. Warum? Weil der Erzieherberuf immer noch eine Frauendomäne ist, Männer die Welt regieren und von 
 Im Verlauf und Auswertung des Förderprogramms „MEHR Männer in die Kitas“ wurde mehr und mehr deutlich, dass sich nicht vorrangig die förderberechtigen Arbeitsuchenden für diese Art der Neuqualifizierung begeisterten, sondern eher lebens- und berufserfahrene Menschen im mittleren Alter mit dem Ziel einer beruflichen Neu- oder Umorientierung. Zudem bieten lang dauernde und nicht vergütete Neuqualifizierungen, die zudem (meist) ohne staatliche
Im Verlauf und Auswertung des Förderprogramms „MEHR Männer in die Kitas“ wurde mehr und mehr deutlich, dass sich nicht vorrangig die förderberechtigen Arbeitsuchenden für diese Art der Neuqualifizierung begeisterten, sondern eher lebens- und berufserfahrene Menschen im mittleren Alter mit dem Ziel einer beruflichen Neu- oder Umorientierung. Zudem bieten lang dauernde und nicht vergütete Neuqualifizierungen, die zudem (meist) ohne staatliche 
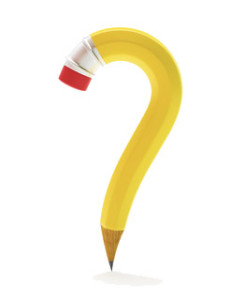
 Notwendigkeit! Modernes
Notwendigkeit! Modernes